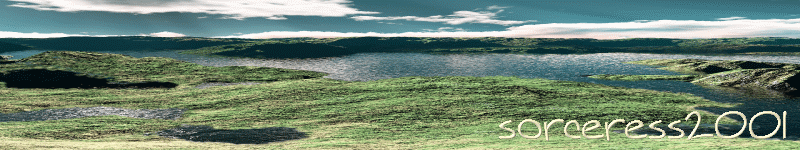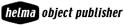Hochzeiten auf dem Land nehmen auch heute noch einen ganz besonderen Stellenwert ein. Die dörfliche Eintönigkeit wird von solch einem Ereignis erfolgreich unterbrochen. Der bewusste Tag wirft bereits Wochen vorher seine Schatten voraus, um danach jammernd in den Nachwehen zu liegen. Oft sind Nachwehen schmerzhafter als die eigentliche Geburt. Zumindest behaupten das alle, in gängigen Ärztemagazinen schreibenden, Gynäkologen.
Bernhard, mein Mann, ist Arzt. Genauer gesagt, Schönheitschirurg. Wir sind seit einem knappen Jahr verheiratet. Kennen gelernt hatten wir uns schon vor langer Zeit, an der Uni. Ich studierte damals Journalistik, er machte seine ersten unbeholfenen Sezierversuche in der forensischen Fachabteilung. Nach unseren Abschlussprüfungen verloren wir uns für vier Jahre vollkommen aus den Augen. Während ich bei einer großen Tageszeitung arbeitete, spezialisierte sich Bernhard im Bereich der plastischen Chirurgie. Wir trafen uns bei einem Ärztekongress wieder. Sein Vortrag über neue Verfahrensweisen zur schmerzfreien Gesichtsstraffung – bemerkenswert-! Ich recherchierte für einen Artikel zum Thema: „Plastische Chirurgie – Fluch oder Segen?“.
Zurzeit arbeitet Bernhard als Chefarzt. Die Privatklinik, am Rand Düsseldorfs gelegen, ist sein Universum und er, ein gefragter Arzt. Als Mann von einigen seiner Assistenzärztinnen umschwärmt, wie eine grelle Neonröhre vom flatterigen Ungeziefer der Nacht. Ich für meinen Teil ziehe es derzeit vor, in unserem gemütlich eingerichteten Stadthaus zu sitzen und an meinem Roman zu arbeiten. Mein Verleger treibt mich seit Wochen fordernd zur Eile. Clarissa, Lektorin und langjährige beste Freundin, gönnt mir kaum die Zeit für eine Tasse Kaffee am Tag. Auf der Buchmesse im Frühjahr soll der Roman schon präsentiert werden.
Letztens erst plauderte die Sekretärin des Verlagschefs aus dem Nähkästchen. „Wir haben die Werbemaschinerie bereits angeworfen, Frau von Hohenstetten. Alle sitzen gespannt in den Startlöchern und warten nur noch darauf, dass Sie Ihren Roman zum Abschluss bringen.“ Kaum war das offene Geheimnis über ihre geschwätzigen Lippen gerutscht, schon klopfte sie sich wie eine kleine Idiotin mit ihren spinnenbeinartigen Fingern auf den Schmollmund. Dieser fast schon paranoid anmutenden Geste folgte ein dümmliches Kichern. „So eine Pute, wenn sie wüsste.“ dachte ich, denn im Moment steckte ich wirklich fest mit meiner Schreiberei. „Entenschnabeliges Blondchen.“ Diese, meine geheime Bezeichnung für sie, versteckte ich, so gut es ging, hinter meinen fest zusammen gebissenen Zähnen. Fast hätte meine spitze Zunge dabei Schaden genommen. Wer weiß, wofür sie im Vorzimmer des Verlagschefs saß. Ganz bestimmt nicht, um ihm als Assistentin den Rücken frei zu halten. Ich hatte Bernhard zwar nie danach gefragt, war mir aber sicher, dass auch sie zu seinen Patientinnen zählte. Vielleicht sollte ich ihn bei nächster Gelegenheit darauf ansprechen. Ich wette, nicht nur der Entenschnabel ist künstlich. Sei’s drum. Sie ist und bleibt, zumindest in meinen Augen, einfach nur eine kleine, dumme Pute.
Während ich die Vertragszusätze in mehrfacher Ausfertigung unterzeichnete, beobachtete ich sie aus den Augenwinkeln. Ich musste mich zur Konzentration zwingen und stellte fest, wie meine Antipathie stetig wuchs. Im Stillen gestand ich mir - nicht ganz neidlos - ein: Sie sah verdammt gut aus. Auch wenn das nichts an ihrer augenscheinlichen Dummheit änderte. Doch so etwas sehen Männer nicht. Sie starren den Frauen wo auch immer hin und sind froh, sich mit derart künstlichen Schönheiten der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen. Solange die Damen den Mund halten, ist ihnen das Paradies auf Erden sicher.
Hastig verabschiedete ich mich von Fräulein „Entenschnabel“ und erschrak, als sie mir honigsüß zusäuselte: „Nicht vergessen, am Sonntag, ich bin so aufgeregt.“ Sonntag? Was zur Hölle ist am Sonntag? In rasender Geschwindigkeit durchforstete ich meine Hirnwindungen, die kleinen grauen Zellen trieben Hochleistungssport. Verdammt, wie konnte ich das nur vergessen? Fräulein „Entenschnabel“ ehelicht am kommenden Sonntag den Juniorchef des Verlagshauses. Die Einladungen hingen schon ewig zu Hause an unserem Flurspiegel. Irgendwie musste ich das wohl verdrängt haben, bis eben. Ich setzte mein schönstes – wenn auch gequältes – Lächeln für sie auf und nuschelte schwach: „Selbstverständlich, wie könnten wir diesen besonderen Tag vergessen? Wir freuen uns schon sehr.“ Eine glatte Lüge. Ich beeilte mich, aus dem Vorzimmer hinauszukommen und war froh, als ich endlich den Fahrstuhl erreichte. Während dieser in Richtung Tiefgarage hinab glitt, betrachtete ich mich im Spiegel. Warum mussten Chefetagenfahrstühle rundum mit Spiegeln ausgestattet sein? Kein noch so winziges Fleckchen gab es, wohin ich mich zurückziehen könnte. Zum Glück war ich allein in der Fahrstuhlkabine. Ich bemerkte, wie ich mich selbst anstarrte, gezwungenermaßen. Als würde ich zum ersten Mal vor einem Spiegel stehen, glitten meine Blicke an mir hinunter. Meine Turnschuhe könnten sich tatsächlich wieder einmal ein Rendezvous mit einem nassen Lappen gönnen. Meine Jeans waren auch nicht mehr die neuesten, aber ich liebte sie. Sind sie doch fast wie meine zweite Haut. Und das rot - schwarz karierte Holzfällerhemd ist mein Glückshemd. Seit ich mit Bernhard in unseren Flitterwochen diese wunderbare Zeit in den USA verbracht hatte, konnte ich mich nur schwer davon trennen.
Mag sein, dass mir die Natur zu viel des Guten angetan hatte, als sie mir das Haar kräuselte. Seit meinen Kindertagen ist es kaum zu bändigen. Damals säuselten meine etwas verschrobenen beiden Tanten verzückt: „Mein Gott, wie reizend.“
Frank, ein schüchterner Junge aus der Oberstufe nannte mich, Jahre später, verschämt sein „Löckchen“. An der Uni nahm man von der wilden Krause auf meinem Schädel kaum noch Notiz. Da gab es weitaus wichtigere Themen zu diskutieren. Ich selbst hatte mich mit meiner nicht zu bändigenden Mähne arrangiert. Wurde sie zu übermütig, stopfte ich sie einfach unter ein Tuch. Bernhard nannte mich dann immer seine „Beduinenkönigin.“ Was waren schon Äußerlichkeiten.
Nachdem ich endlich in der Tiefgarage ankam, suchte ich meinen kleinen Rover. Zu dumm, dass ich mir nie merken konnte, wo ich ihn abgestellt hatte. Sollte ich irgendwann einmal ein neues Auto brauchen, muss es unbedingt ein funkgesteuertes Widerauffindsystem haben. Gibt es so etwas eigentlich? Keine Ahnung, falls nicht, muss es eben jemand erfinden. Basta.
Bernhard war noch nicht zu Hause, umso besser. So hatte ich noch ein wenig Ruhe, um an meinem Roman weiter zu arbeiten. Zu blöd, dass mir absolut nichts einfallen wollte. An manchen Tagen könnte ich Seite um Seite auf die Festplatte meines Computers bannen. An anderen Tagen ging gar nichts. Vielleicht lag es daran, dass mir diesmal die Themenvorgabe des Verlages nicht schmecken mag. Ich war es gewohnt, meine Storys aus dem täglichen Leben zu saugen. An jeder Ecke passierten aufregende Dinge. Richtig gute Geschichten schreibt doch nur das wahre Leben. Warum nahm das eigentlich außer mir kaum jemand zur Kenntnis? Clarissa sagte immer: „Schätzchen, das wahre Leben interessiert keinen Menschen. Wenn sich jemand ein Buch kauft, dann doch nur, um dem realen Wahnsinn wenigstens für einen kurzen Moment zu entfliehen. Wer will schon lesen, was er täglich selbst erleben könnte?“ Ich sah das allerdings etwas anders. Oft schaute ich stundenlang dem Strom der Menschen zu, die geschäftig wie Ameisen an mir vorüberwuselten, während ich gemütlich in meinem Lieblingscafé saß und meine heiße Schokolade genüsslich trank. Ich musterte ihre Gesichter, um darin zu lesen und beobachtete die Pärchen am Nachbartisch. Wenn ich auch nur die winzigsten Gesprächsfetzen erhaschen konnte, entwickelte ich in Gedanken bereits die nächsten Geschichten.
Heute ist Sonntag und es ist viel zu früh am Morgen. Der Wecker zeigt die Zeit: 6 Uhr 30. Bernhard weilt noch in seinen Träumen, während mir bereits vor dem anstehenden Hochzeitszauber graut. Ich habe keine Lust, dem Juniorchef freundlich die Hand zu drücken und ihm von Herzen alles Gute zu wünschen. Fast schon tut mir der „Entenschnabel“ Leid. In ihrer gnadenlosen Blindheit scheint sie nicht zu merken, dass der Junior nicht der Mann ist, an dessen Seite sie ihr Leben verbringen sollte. Er ist ein Macho, wie er im Buche steht. Doch vielleicht ziehen sich Dummheit und Machogehabe ja gerade an, bedingen sich sogar. Hinter vorgehaltener Hand flüsterte man sich im Verlag die reinsten Horrorgeschichten zu. Öfter als einmal musste der Senior seinen Spross aus polizeilichem Gewahrsam holen. Natürlich wurde gemunkelt, doch die Presse– und Rechtsabteilung des Verlagshauses dementierte bisher alle Anschuldigungen erfolgreich. Ich traute dem Frieden nicht mehr.
Mit einem sanften Kuss hole ich Bernhard aus dem Reich seiner Träume in die Gegenwart und gehe ins Bad, um ausgiebig zu duschen und mich anzukleiden. Schließlich ist eine Hochzeit kein Volksfest, bei dem die Kleiderordnung egal ist. Außerdem werden sich heute sämtliche VIPs der Literaturbranche in der kleinen Dorfkapelle den Rang ablaufen. Nein, nein, man geht nicht einfach zu dieser Hochzeit. Selbst bei solch einer Feierlichkeit nimmt man seine ureigensten Geschäftsinteressen wahr. Das Karussell der Eitelkeiten dreht sich immer und überall.
Während ich versuche, meine nasse Mähne zu zähmen, kommt Bernhard ins Badezimmer. „Vergiss es, die Hochzeit ist geplatzt.“ Blitzartig drehe ich mich zu ihm um und schaue ihn fragend an. Schon ist er aus dem Badezimmer verschwunden und kramt in seinem Notfallkoffer. Dieser ist in Ordnung, wie immer. Während er sich eilig seine Klamotten über wirft, erzählt er in Bruchstücken von dem Anruf, der ihn eben erreicht hat. Es gab vor dreißig Minuten eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Braut und Bräutigam. Sie wird gerade schwer verletzt in die Klinik gebracht. „Uff“, selbst der „Entenschnabel“ hat das nicht verdient. Erst recht nicht an ihrem Hochzeitstag. Bernhard ist schon halb aus der Tür. Ich schnappe meine Strickjacke und folge ihm. Mit dem Auto erreichen wir zehn Minuten später die Klinik. In der Unfallaufnahme wartet bereits das Notfallteam. Während Bernhard sich im Stationsflur seinen OP – Kittel überzieht und hinter der Sicherheitstür verschwindet, gehe ich in den Aufenthaltsraum. Dort sitzt Clarissa, total verheult und starrt ins Leere. Als sie mich sieht, springt sie auf und eilt mir entgegen:„Dieses miese Schwein, dieser perverse Dreckskerl!“, ruft sie immer wieder. Sie kann sich kaum beruhigen, vollkommen außer sich stößt sie die übelsten Verwünschungen aus. Ich setze mich behutsam zu ihr, befehle ihr, sich zu beherrschen. Wenig später stehe ich auf, ziehe am Automaten einen Becher Kaffee. Den drücke ich ihr in beide Hände, nicht, ohne sie zu warnen. Der Kaffee ist heiß. „Geh mir weg mit deinem Kaffee!“, zischt sie mir zu. „Wenn ich den Kerl erwische, ich vergesse mich.“ So hatte ich Clarissa nie zuvor erlebt. Da ich immer noch nicht weiß, was vorgefallen war, rede ich zunächst beruhigend auf sie ein. Das scheint zu wirken, wenn auch nur langsam. Nach und nach kommt Clarissa wieder zu sich. Dann erzählt sie mir, was vor ungefähr einer Stunde in der Villa des Verlagschefs passierte.
Sie war gerade im Brautzimmer, um dem „Entenschnabel“ beim Ankleiden behilflich zu sein. Schließlich zählt dies zu den Aufgaben einer Brautjungfer. Plötzlich, mit einem heftigen Knall, splitterte die Tür des Ankleidezimmers und in ihrem Rahmen baute sich der Bräutigam auf, schnaubend wie ein wilder Stier. Bevor die beiden Frauen auch nur ein Wort sagen konnten, stürzte er sich auf seine zukünftige Frau, riss ihren Arm fast aus dem Schultergelenk und schleuderte sie an die gegenüberliegende Wand. „Zuerst war nur ein Knirschen zu hören, vom Aufprall ihres Schädels“, sagt Clarissa, „kurz darauf spritzte ihr das Blut aus Nase und Ohren.“ Zum Schreien blieb keine Zeit. Wie ein alles vernichtender Tornado tobte sich der Kerl an seiner Zukünftigen aus. Immer wieder schlug er in ihr schmerzverzerrtes Gesicht. Beschimpfte sie mit Worten, die Clarissa nicht wiederholen wollte. Das alles passierte rasend schnell, war so unwirklich, dass Clarissa dem Ganzen hilflos gegenüberstand. Nicht einmal, als die Geprügelte blutüberströmt am Boden lag, ließ er von ihr ab. Die herbeieilenden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten ihn nur mit Mühe von ihr wegzerren. Wie besessen schlug er auf alles ein, was ihm vor die Fäuste geriet. Glücklicherweise ist ein enger Freund der Familie ebenfalls Arzt und war bereits früh in der Villa anwesend. Als er im Ankleidezimmer eintraf, atmete die junge Frau kaum noch. Sie lag da, in ihrem kurz zuvor noch blütenweißen Kleid. Ihr Gesicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt, nicht nur das Kleid in Fetzen. Es schien, als würde sie jeden Moment die Schwelle vom Leben zum Tod überschreiten wollen. Rettungswagen und Polizei trafen fast gleichzeitig ein. Den Schläger brachte man auf das nächstgelegene Polizeirevier, Die lebensgefährlich Verletzte auf die Unfallstation der Düsseldorfer Privatklinik, dafür hatte Clarissa gesorgt.
Die Ehe war beendet, bevor sie begonnen hatte.
Die Hintergründe des Vorfalles hatte der Familienanwalt für den Juniorchef zum Vorteil, für die Presse höchst plausibel in den nächsten Tagen zu erläutern versucht. Wie schon so oft. Er ist ein meisterlicher Rechtsverdreher. Den Auslöser für das Verhalten des Schlägers wird die Öffentlichkeit nie erfahren. Der Richter fällte sein Urteil.
In den Tagen und Wochen nach diesem Ereignis machte mein neu begonnener Roman rasante Fortschritte. Wider Erwarten. Das vom Verlag ursprünglich gewünschte Buch, mit dem Titel „Hochzeitsglocken“ werde ich vielleicht irgendwann zu Ende schreiben.
Der Titel meines erst gestern veröffentlichten Werkes: „Gewalttätigkeit – Kein Kavaliersdelikt“. Das bin ich, nicht nur dem „Fräulein Entenschnabel“, einfach schuldig.