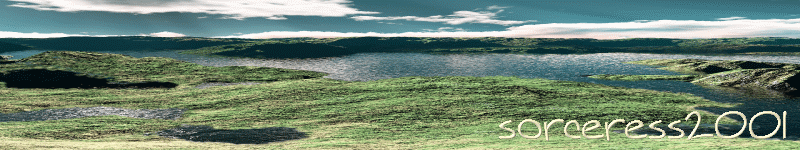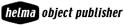Mitten in Montana (Zeitschrift Kurzgeschichten 11/2005)
sorceress2001
09:56h
Mein Job als Trucker dient nicht allein meinem Broterwerb, vielmehr ist er meine Berufung. Seit zwei Jahrzehnten führen mich meine Touren kreuz und quer durch das ganze Land. Dabei sind mir mit der Zeit viele Menschen begegnet, deren Schicksale und Geschichten so unterschiedlich waren, wie die Routen, auf denen ich fuhr. Meine Heimat ist die Landstraße, so und nicht anders wollte ich es immer haben. Heute führt mich mein Weg durch Montana. Bevor ich den Pass überquere, werde ich bei Mary’s Diner anhalten, und mir einen ordentlichen Becher heißen Kaffee gönnen. Mary kocht den besten Kaffee weit und breit. Abgesehen davon, hat sie noch einige andere Vorzüge, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte.
Jackson Hole liegt bereits einige Meilen hinter mir. Um die Nacht nicht zu lang werden zu lassen, stelle ich mein Radio auf „Jim’s Western Music“- Frequenz.
Jim und ich kennen uns schon, so lange wir beide denken können, noch aus der Zeit, als er selbst als Ritter der Landstraßen unterwegs war. Bis eines Tages ein schrecklicher Unfall seinem Trucker-Dasein ein jähes Ende bereitete.
Ich erinnere mich, als wäre es erst gestern passiert. Es war eine Nacht wie diese und es regnete in Strömen. Über Funk hatte ich gerade mit Jim vereinbart, bei Mary eine kurze Pause ein zu legen, etwas Ruhe und Entspannung konnten wir beide gebrauchen. Jim fuhr damals durch den Yellowstone, er hatte Bauholz geladen. Die Mormonen in einer Siedlung kurz vor Salt Lake City bestanden darauf, genau dieses Holz zum Bau ihres neuen Gebetshauses zu verwenden.
Jim war auf jeden Cent angewiesen. Er wusste, dass diese Tour gefährlich sein konnte, dennoch hatte er den Auftrag angenommen.
Während wir über Funk Kontakt hielten, schien das Wetter im Umkreis des Yellowstone vollkommen verrückt zu spielen. Das Letzte, was ich von Jim damals hörte, war sein Fluch über „Old faithful“. Die Fontänen des Geysirs waren scheinbar aus dem natürlichen Gleichgewicht geraten. Jim schrie: „Dieses Mistding spuckt Steine anstatt Wasser! Was ist da los?“ Für einen Moment war der Funk unterbrochen, dann hörte ich Jim abermals brüllen: “Verdammter Schneesturm, spielt hier alles verrückt?“ Der Funk brach kurzzeitig ab. Als die Verbindung wieder stand, hörte ich einen mächtigen Knall, Glas splitterte, Jim schrie und das Geräusch von herabstürzenden Felsbrocken nahm minutenlang kein Ende.
Ich informierte sofort die Ranger der nächstliegenden Station. Wie sich herausstellte, hatten diese den Vorfall über Funk miterlebt und waren bereits unterwegs. Allein diesem Umstand hatte Jim sein Leben zu verdanken. Schwer verletzt bargen ihn die Ranger fünfundzwanzig Minuten später aus dem brennenden Fahrzeug.
Der Truck war nur noch ein Haufen Schrott und das Bauholz der Mormonen verbrannte bei der Explosion des Tanks bis auf den letzten Stamm.
Nach seiner Genesung musste Jim die Truckfahrerei an den Nagel hängen. Er zahlt heute noch Raten an die Mormonen ab, indem er Radiosendungen für Trucker moderiert. Nächstenliebe ist den Ältesten der Mormonen anscheinend, trotz aller Gläubigkeit, in Jims Fall vollkommen fremd. Noch ungefähr zehn Meilen liegen vor mir, dann erwartet mich Marys starker Kaffee. Wenn es weiter so regnet wie im Moment, werde ich heute Nacht bei ihr bleiben müssen. Sie wird erfreut sein, meinen Zeitplan bringt es ganz schön durcheinander.
Ja, ich gebe zu, Mary ist eine Traumfrau, sie hat nur einen Makel, seit Jahren drängt sie mich dazu, meinen Job aufzugeben und sie zu heiraten.
Für mich wäre dies gleichbedeutend mit dem Tod. Selbst eine Frau wie sie ist nicht in der Lage, mich dazu zu bringen.
Ein klopfendes Geräusch reißt mich aus meinen Gedanken. Ich drehe Jims Musiksendung etwas leiser, doch das Klopfen lässt nicht nach. Das hat mir gerade noch gefehlt, mitten in der Nacht, weit und breit keine Menschenseele. Der Regen hat immer noch nicht aufgehört. Das Klopfen entwickelt sich zu einem bedrohlichen Geräusch und der Motor beginnt zu stottern. Verflucht! Ich hätte den Motor des Trucks letzte Woche noch einmal durchsehen lassen sollen, in Bobs Werkstatt. Dabei hatte ich Bobs Worten kaum eine Bedeutung zugemessen, denn sein Geschäftssinn ist mir seit vielen Jahren nicht unbekannt. Ich gab also nicht viel auf Bobs Worte und schlug seine Warnungen mit einer abwinkenden Handbewegung aus.
„Mist!“ Nun steht die verfluchte Karre tatsächlich still. Normalerweise kostet es mich nicht viel Überwindung, selbst nach dem Rechten zu sehen, mit den Jahren lernt man so einiges. „Wenn nur dieses Sauwetter nicht wäre!“
Ich muss die Warnlichter aufstellen, glücklicherweise habe ich mein Handy dabei und kann den Abschleppdienst rufen. Da fällt mir ein, hier ist die mieseste Stelle, um zu telefonieren. Die Signale werden durch die Berge beeinträchtigt, auch mein Funkgerät wird mir nicht viel nützen. „Wo zur Hölle bin ich hier eigentlich?“
Also schön, trotz des Regens muss ich mich durch den Wald kämpfen bis zu Mary’s Diner, um von dort aus den Abschleppdienst anzurufen. Der Empfang ist hier tatsächlich total gestört.
Missmutig steige ich aus, werfe mein Regenzeug über, greife meine Taschenlampe und mache mich auf den Weg. Das Beste wird sein, ich gehe quer durch den Wald, so kann ich sicher sein, Mary’s Diner schneller zu erreichen. „Hölle, ist das stürmisch!“
Seit knapp einer Stunde irre ich umher, das Licht meiner Taschenlampe verschafft mir nur begrenzte Sicht. Ich habe mich verlaufen. Wen wundert’s, meine Berufung ist das Truckfahren und die Landstraße, nicht der Querfeldeinlauf. Dort vorn scheint sich der Wald zu lichten, endlich. Dann noch zwei Meilen die Straße entlang und Mary’s Laden müsste schon zu sehen sein. „Verdammt, ist mir kalt!“
Ich beginne zu rennen und merke, dass es mir an einer gehörigen Portion Kondition mangelt. Mary hatte Recht, als sie vor einigen Wochen eine spitze Bemerkung über meinen üppigen Bauch machte.
„Endlich, Licht.“ Vollkommen außer Atem kämpfe ich mich die letzten Meter durch das Unterholz. „Was ist das?“ Ich hatte angenommen nun die Landstraße erreicht zu haben, doch: weit gefehlt. Während ich mir das nasse Laub aus den Haaren streife, sehe ich einen Lichtstrahl, erst schwach, dann wird er immer heller und breiter. Inmitten des Lichtkegels ein pyramidenförmiges Etwas. Davor drei dürre Gestalten, die mich aus großen Augen erschrocken ansehen. Wie erstarrt bleibe ich stehen.
„Aliens mitten in Montana, das glaubt mir kein Mensch!“ Wie es aussieht, haben auch sie eine Panne mit ihrer fliegenden Untertasse. Hatte Jim damals nicht auch irgendetwas von Aliens gefaselt? Ich hielt es für wirres Gerede auf Grund seines Unfallschocks. Jetzt weiß ich es besser.
Hochzeitsglocken (Zeitschrift Kurzgeschichten 06/2005)
sorceress2001
11:17h
Hochzeiten auf dem Land nehmen auch heute noch einen ganz besonderen Stellenwert ein. Die dörfliche Eintönigkeit wird von solch einem Ereignis erfolgreich unterbrochen. Der bewusste Tag wirft bereits Wochen vorher seine Schatten voraus, um danach jammernd in den Nachwehen zu liegen. Oft sind Nachwehen schmerzhafter als die eigentliche Geburt. Zumindest behaupten das alle, in gängigen Ärztemagazinen schreibenden, Gynäkologen. Bernhard, mein Mann, ist Arzt. Genauer gesagt, Schönheitschirurg. Wir sind seit einem knappen Jahr verheiratet. Kennen gelernt hatten wir uns schon vor langer Zeit, an der Uni. Ich studierte damals Journalistik, er machte seine ersten unbeholfenen Sezierversuche in der forensischen Fachabteilung. Nach unseren Abschlussprüfungen verloren wir uns für vier Jahre vollkommen aus den Augen. Während ich bei einer großen Tageszeitung arbeitete, spezialisierte sich Bernhard im Bereich der plastischen Chirurgie. Wir trafen uns bei einem Ärztekongress wieder. Sein Vortrag über neue Verfahrensweisen zur schmerzfreien Gesichtsstraffung – bemerkenswert-! Ich recherchierte für einen Artikel zum Thema: „Plastische Chirurgie – Fluch oder Segen?“. Zurzeit arbeitet Bernhard als Chefarzt. Die Privatklinik, am Rand Düsseldorfs gelegen, ist sein Universum und er, ein gefragter Arzt. Als Mann von einigen seiner Assistenzärztinnen umschwärmt, wie eine grelle Neonröhre vom flatterigen Ungeziefer der Nacht. Ich für meinen Teil ziehe es derzeit vor, in unserem gemütlich eingerichteten Stadthaus zu sitzen und an meinem Roman zu arbeiten. Mein Verleger treibt mich seit Wochen fordernd zur Eile. Clarissa, Lektorin und langjährige beste Freundin, gönnt mir kaum die Zeit für eine Tasse Kaffee am Tag. Auf der Buchmesse im Frühjahr soll der Roman schon präsentiert werden.
Letztens erst plauderte die Sekretärin des Verlagschefs aus dem Nähkästchen. „Wir haben die Werbemaschinerie bereits angeworfen, Frau von Hohenstetten. Alle sitzen gespannt in den Startlöchern und warten nur noch darauf, dass Sie Ihren Roman zum Abschluss bringen.“ Kaum war das offene Geheimnis über ihre geschwätzigen Lippen gerutscht, schon klopfte sie sich wie eine kleine Idiotin mit ihren spinnenbeinartigen Fingern auf den Schmollmund. Dieser fast schon paranoid anmutenden Geste folgte ein dümmliches Kichern. „So eine Pute, wenn sie wüsste.“ dachte ich, denn im Moment steckte ich wirklich fest mit meiner Schreiberei. „Entenschnabeliges Blondchen.“ Diese, meine geheime Bezeichnung für sie, versteckte ich, so gut es ging, hinter meinen fest zusammen gebissenen Zähnen. Fast hätte meine spitze Zunge dabei Schaden genommen. Wer weiß, wofür sie im Vorzimmer des Verlagschefs saß. Ganz bestimmt nicht, um ihm als Assistentin den Rücken frei zu halten. Ich hatte Bernhard zwar nie danach gefragt, war mir aber sicher, dass auch sie zu seinen Patientinnen zählte. Vielleicht sollte ich ihn bei nächster Gelegenheit darauf ansprechen. Ich wette, nicht nur der Entenschnabel ist künstlich. Sei’s drum. Sie ist und bleibt, zumindest in meinen Augen, einfach nur eine kleine, dumme Pute.
Während ich die Vertragszusätze in mehrfacher Ausfertigung unterzeichnete, beobachtete ich sie aus den Augenwinkeln. Ich musste mich zur Konzentration zwingen und stellte fest, wie meine Antipathie stetig wuchs. Im Stillen gestand ich mir - nicht ganz neidlos - ein: Sie sah verdammt gut aus. Auch wenn das nichts an ihrer augenscheinlichen Dummheit änderte. Doch so etwas sehen Männer nicht. Sie starren den Frauen wo auch immer hin und sind froh, sich mit derart künstlichen Schönheiten der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen. Solange die Damen den Mund halten, ist ihnen das Paradies auf Erden sicher.
Hastig verabschiedete ich mich von Fräulein „Entenschnabel“ und erschrak, als sie mir honigsüß zusäuselte: „Nicht vergessen, am Sonntag, ich bin so aufgeregt.“ Sonntag? Was zur Hölle ist am Sonntag? In rasender Geschwindigkeit durchforstete ich meine Hirnwindungen, die kleinen grauen Zellen trieben Hochleistungssport. Verdammt, wie konnte ich das nur vergessen? Fräulein „Entenschnabel“ ehelicht am kommenden Sonntag den Juniorchef des Verlagshauses. Die Einladungen hingen schon ewig zu Hause an unserem Flurspiegel. Irgendwie musste ich das wohl verdrängt haben, bis eben. Ich setzte mein schönstes – wenn auch gequältes – Lächeln für sie auf und nuschelte schwach: „Selbstverständlich, wie könnten wir diesen besonderen Tag vergessen? Wir freuen uns schon sehr.“ Eine glatte Lüge. Ich beeilte mich, aus dem Vorzimmer hinauszukommen und war froh, als ich endlich den Fahrstuhl erreichte. Während dieser in Richtung Tiefgarage hinab glitt, betrachtete ich mich im Spiegel. Warum mussten Chefetagenfahrstühle rundum mit Spiegeln ausgestattet sein? Kein noch so winziges Fleckchen gab es, wohin ich mich zurückziehen könnte. Zum Glück war ich allein in der Fahrstuhlkabine. Ich bemerkte, wie ich mich selbst anstarrte, gezwungenermaßen. Als würde ich zum ersten Mal vor einem Spiegel stehen, glitten meine Blicke an mir hinunter. Meine Turnschuhe könnten sich tatsächlich wieder einmal ein Rendezvous mit einem nassen Lappen gönnen. Meine Jeans waren auch nicht mehr die neuesten, aber ich liebte sie. Sind sie doch fast wie meine zweite Haut. Und das rot - schwarz karierte Holzfällerhemd ist mein Glückshemd. Seit ich mit Bernhard in unseren Flitterwochen diese wunderbare Zeit in den USA verbracht hatte, konnte ich mich nur schwer davon trennen.
Mag sein, dass mir die Natur zu viel des Guten angetan hatte, als sie mir das Haar kräuselte. Seit meinen Kindertagen ist es kaum zu bändigen. Damals säuselten meine etwas verschrobenen beiden Tanten verzückt: „Mein Gott, wie reizend.“
Frank, ein schüchterner Junge aus der Oberstufe nannte mich, Jahre später, verschämt sein „Löckchen“. An der Uni nahm man von der wilden Krause auf meinem Schädel kaum noch Notiz. Da gab es weitaus wichtigere Themen zu diskutieren. Ich selbst hatte mich mit meiner nicht zu bändigenden Mähne arrangiert. Wurde sie zu übermütig, stopfte ich sie einfach unter ein Tuch. Bernhard nannte mich dann immer seine „Beduinenkönigin.“ Was waren schon Äußerlichkeiten.
Nachdem ich endlich in der Tiefgarage ankam, suchte ich meinen kleinen Rover. Zu dumm, dass ich mir nie merken konnte, wo ich ihn abgestellt hatte. Sollte ich irgendwann einmal ein neues Auto brauchen, muss es unbedingt ein funkgesteuertes Widerauffindsystem haben. Gibt es so etwas eigentlich? Keine Ahnung, falls nicht, muss es eben jemand erfinden. Basta. Bernhard war noch nicht zu Hause, umso besser. So hatte ich noch ein wenig Ruhe, um an meinem Roman weiter zu arbeiten. Zu blöd, dass mir absolut nichts einfallen wollte. An manchen Tagen könnte ich Seite um Seite auf die Festplatte meines Computers bannen. An anderen Tagen ging gar nichts. Vielleicht lag es daran, dass mir diesmal die Themenvorgabe des Verlages nicht schmecken mag. Ich war es gewohnt, meine Storys aus dem täglichen Leben zu saugen. An jeder Ecke passierten aufregende Dinge. Richtig gute Geschichten schreibt doch nur das wahre Leben. Warum nahm das eigentlich außer mir kaum jemand zur Kenntnis? Clarissa sagte immer: „Schätzchen, das wahre Leben interessiert keinen Menschen. Wenn sich jemand ein Buch kauft, dann doch nur, um dem realen Wahnsinn wenigstens für einen kurzen Moment zu entfliehen. Wer will schon lesen, was er täglich selbst erleben könnte?“ Ich sah das allerdings etwas anders. Oft schaute ich stundenlang dem Strom der Menschen zu, die geschäftig wie Ameisen an mir vorüberwuselten, während ich gemütlich in meinem Lieblingscafé saß und meine heiße Schokolade genüsslich trank. Ich musterte ihre Gesichter, um darin zu lesen und beobachtete die Pärchen am Nachbartisch. Wenn ich auch nur die winzigsten Gesprächsfetzen erhaschen konnte, entwickelte ich in Gedanken bereits die nächsten Geschichten. Heute ist Sonntag und es ist viel zu früh am Morgen. Der Wecker zeigt die Zeit: 6 Uhr 30. Bernhard weilt noch in seinen Träumen, während mir bereits vor dem anstehenden Hochzeitszauber graut. Ich habe keine Lust, dem Juniorchef freundlich die Hand zu drücken und ihm von Herzen alles Gute zu wünschen. Fast schon tut mir der „Entenschnabel“ Leid. In ihrer gnadenlosen Blindheit scheint sie nicht zu merken, dass der Junior nicht der Mann ist, an dessen Seite sie ihr Leben verbringen sollte. Er ist ein Macho, wie er im Buche steht. Doch vielleicht ziehen sich Dummheit und Machogehabe ja gerade an, bedingen sich sogar. Hinter vorgehaltener Hand flüsterte man sich im Verlag die reinsten Horrorgeschichten zu. Öfter als einmal musste der Senior seinen Spross aus polizeilichem Gewahrsam holen. Natürlich wurde gemunkelt, doch die Presse– und Rechtsabteilung des Verlagshauses dementierte bisher alle Anschuldigungen erfolgreich. Ich traute dem Frieden nicht mehr. Mit einem sanften Kuss hole ich Bernhard aus dem Reich seiner Träume in die Gegenwart und gehe ins Bad, um ausgiebig zu duschen und mich anzukleiden. Schließlich ist eine Hochzeit kein Volksfest, bei dem die Kleiderordnung egal ist. Außerdem werden sich heute sämtliche VIPs der Literaturbranche in der kleinen Dorfkapelle den Rang ablaufen. Nein, nein, man geht nicht einfach zu dieser Hochzeit. Selbst bei solch einer Feierlichkeit nimmt man seine ureigensten Geschäftsinteressen wahr. Das Karussell der Eitelkeiten dreht sich immer und überall.
Während ich versuche, meine nasse Mähne zu zähmen, kommt Bernhard ins Badezimmer. „Vergiss es, die Hochzeit ist geplatzt.“ Blitzartig drehe ich mich zu ihm um und schaue ihn fragend an. Schon ist er aus dem Badezimmer verschwunden und kramt in seinem Notfallkoffer. Dieser ist in Ordnung, wie immer. Während er sich eilig seine Klamotten über wirft, erzählt er in Bruchstücken von dem Anruf, der ihn eben erreicht hat. Es gab vor dreißig Minuten eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Braut und Bräutigam. Sie wird gerade schwer verletzt in die Klinik gebracht. „Uff“, selbst der „Entenschnabel“ hat das nicht verdient. Erst recht nicht an ihrem Hochzeitstag. Bernhard ist schon halb aus der Tür. Ich schnappe meine Strickjacke und folge ihm. Mit dem Auto erreichen wir zehn Minuten später die Klinik. In der Unfallaufnahme wartet bereits das Notfallteam. Während Bernhard sich im Stationsflur seinen OP – Kittel überzieht und hinter der Sicherheitstür verschwindet, gehe ich in den Aufenthaltsraum. Dort sitzt Clarissa, total verheult und starrt ins Leere. Als sie mich sieht, springt sie auf und eilt mir entgegen:„Dieses miese Schwein, dieser perverse Dreckskerl!“, ruft sie immer wieder. Sie kann sich kaum beruhigen, vollkommen außer sich stößt sie die übelsten Verwünschungen aus. Ich setze mich behutsam zu ihr, befehle ihr, sich zu beherrschen. Wenig später stehe ich auf, ziehe am Automaten einen Becher Kaffee. Den drücke ich ihr in beide Hände, nicht, ohne sie zu warnen. Der Kaffee ist heiß. „Geh mir weg mit deinem Kaffee!“, zischt sie mir zu. „Wenn ich den Kerl erwische, ich vergesse mich.“ So hatte ich Clarissa nie zuvor erlebt. Da ich immer noch nicht weiß, was vorgefallen war, rede ich zunächst beruhigend auf sie ein. Das scheint zu wirken, wenn auch nur langsam. Nach und nach kommt Clarissa wieder zu sich. Dann erzählt sie mir, was vor ungefähr einer Stunde in der Villa des Verlagschefs passierte.
Sie war gerade im Brautzimmer, um dem „Entenschnabel“ beim Ankleiden behilflich zu sein. Schließlich zählt dies zu den Aufgaben einer Brautjungfer. Plötzlich, mit einem heftigen Knall, splitterte die Tür des Ankleidezimmers und in ihrem Rahmen baute sich der Bräutigam auf, schnaubend wie ein wilder Stier. Bevor die beiden Frauen auch nur ein Wort sagen konnten, stürzte er sich auf seine zukünftige Frau, riss ihren Arm fast aus dem Schultergelenk und schleuderte sie an die gegenüberliegende Wand. „Zuerst war nur ein Knirschen zu hören, vom Aufprall ihres Schädels“, sagt Clarissa, „kurz darauf spritzte ihr das Blut aus Nase und Ohren.“ Zum Schreien blieb keine Zeit. Wie ein alles vernichtender Tornado tobte sich der Kerl an seiner Zukünftigen aus. Immer wieder schlug er in ihr schmerzverzerrtes Gesicht. Beschimpfte sie mit Worten, die Clarissa nicht wiederholen wollte. Das alles passierte rasend schnell, war so unwirklich, dass Clarissa dem Ganzen hilflos gegenüberstand. Nicht einmal, als die Geprügelte blutüberströmt am Boden lag, ließ er von ihr ab. Die herbeieilenden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten ihn nur mit Mühe von ihr wegzerren. Wie besessen schlug er auf alles ein, was ihm vor die Fäuste geriet. Glücklicherweise ist ein enger Freund der Familie ebenfalls Arzt und war bereits früh in der Villa anwesend. Als er im Ankleidezimmer eintraf, atmete die junge Frau kaum noch. Sie lag da, in ihrem kurz zuvor noch blütenweißen Kleid. Ihr Gesicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt, nicht nur das Kleid in Fetzen. Es schien, als würde sie jeden Moment die Schwelle vom Leben zum Tod überschreiten wollen. Rettungswagen und Polizei trafen fast gleichzeitig ein. Den Schläger brachte man auf das nächstgelegene Polizeirevier, Die lebensgefährlich Verletzte auf die Unfallstation der Düsseldorfer Privatklinik, dafür hatte Clarissa gesorgt. Die Ehe war beendet, bevor sie begonnen hatte. Die Hintergründe des Vorfalles hatte der Familienanwalt für den Juniorchef zum Vorteil, für die Presse höchst plausibel in den nächsten Tagen zu erläutern versucht. Wie schon so oft. Er ist ein meisterlicher Rechtsverdreher. Den Auslöser für das Verhalten des Schlägers wird die Öffentlichkeit nie erfahren. Der Richter fällte sein Urteil. In den Tagen und Wochen nach diesem Ereignis machte mein neu begonnener Roman rasante Fortschritte. Wider Erwarten. Das vom Verlag ursprünglich gewünschte Buch, mit dem Titel „Hochzeitsglocken“ werde ich vielleicht irgendwann zu Ende schreiben. Der Titel meines erst gestern veröffentlichten Werkes: „Gewalttätigkeit – Kein Kavaliersdelikt“. Das bin ich, nicht nur dem „Fräulein Entenschnabel“, einfach schuldig.
Im Wechsel der Jahre (Zeitschrift Kurzgeschichten 01/2005)
sorceress2001
11:15h
Vermutlich war Harrison Ford nicht ganz unschuldig daran, dass sich Stephanie du Bois in Jackson Hole niedergelassen hatte. Oder vielleicht lag es an dem tief, in ihrem Inneren wohnenden Fernweh? An den Indianerfilmen, welche sie als kleines Mädchen mit Begeisterung sah? Woran es auch gelegen haben mag, so lange sie sich zurück erinnern konnte, war es ihr Wunsch, in Amerika zu leben. Sie träumte bereits als Teenager von der viel gerühmten Freiheit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Von den Abenteuern des Lebens, von faszinierenden Landschaften, endlosen Weiten. Vor mehr als 10 Jahren hatte sie Deutschland verlassen um ihren Traum zu leben und ihrem Albtraum zu entfliehen. Kurz nach dem Unfalltod ihres Mannes verkaufte sie alles was sie besaß, nichts sollte sie mehr an die Vergangenheit erinnern. Nur ein Foto behielt sie von ihm.
Bob, ihr Mann, wollte keine Kinder. Zumindest nicht so kurz nach der Hochzeit. Oft und eigentlich nur deshalb kam es zu Auseinandersetzungen zwischen ihnen beiden. Er wollte zuerst an seiner Karriere arbeiten. Damit sie gemeinsam und unbesorgt in die Zukunft blicken könnten. Jedes Mal, wenn sie ihn darauf ansprach, antwortete er, „später, Schatz, dass hat noch Zeit“.
Während ihre Freundinnen sich über die tauglichsten Babywindeln stundenlang die Köpfe heiß redeten oder stritten, welches Spielzeug für Säuglinge pädagogisch besonders wertvoll erschien, blickte Stephanie sehnsüchtig in die niedlichen Babygesichter. Gedanklich malte sie sich aus, wie es wäre, so ein kleines Bündel Leben in den eigenen Armen zu halten. Es zu lieben und zu umsorgen, mit ihm zu lachen und zu weinen. Wie durch eine Nebelwand hörte sie von Ferne Bob’s sonore Stimme: „Wir haben Zeit, wir sind noch jung, Liebes. Lass uns später darüber nachdenken.“
Dann dieser schreckliche Tag. Der Silvesterabend 1994. Bob wollte noch einmal kurz in die Firma. Das Architekturunternehmen „Hansen & Partner“ hatte alle überarbeiteten Zeichnungen und Pläne für das bereits im Bau befindliche Einkaufszentrum geschickt. Bob musste dringend einen Blick hinein werfen um eine neue Preiskalkulation zu erstellen. Ausgerechnet am Silvesterabend. Musste das sein? Stephanies Eltern gaben eine Party zum Jahreswechsel. Sie wollten Bob einige neue und viel versprechende Auftraggeber vorstellen. Der alte du Bois war ein ausgebuffter Geschäftsmann. Er hatte die Baufirma zu dem gemacht, was sie heute ist. Gern hätte er sie seinem Sohn vererbt, doch Stephanies Bruder war nicht interessiert. Sein Interesse galt mehr der Verschwendung des Familienerbes, als einer geregelten Arbeit. Alle Hoffnungen des Alten, wie ihn alle liebevoll jedoch nicht ohne Respekt nannten, lagen auf den Schultern seines Schwiegersohnes. Für Bob ein echter Glücksfall, sich ausgerechnet in Stephanie zu verlieben. Damals, 5 Jahre zu vor.
Stephanie war bereits für die Party umgezogen und wartete ungeduldig auf die Rückkehr ihres Mannes. Ihre Mutter mochte es nicht besonders, wenn man sich zu ihren Partys verspätete. Und Stephanie wusste, wie wichtig neue Kontakte für Bob waren. Die Baubranche florierte im Moment nicht besonders. Das Geld war knapp, besonders bei den Bauherren. Aufträge waren nicht gerade üppig gesät.
Während sie noch einmal ihr Make up auffrischte, klingelte es an der Tür. Stephanie wunderte sich, denn Bob ging nie ohne Schlüssel aus dem Haus. Als sie die Treppe von der oberen Etage des Hauses nach unten kam, sah sie bereits durch die verglaste Haustür das flackernde Licht vom Dach des Polizeieinsatzwagens. Ihr Magen krampfte sich augenblicklich zusammen und sofort beschlich sie ein ungutes Gefühl. Sie öffnete die Haustür. Ihr gegenüber standen zwei Beamte der Verkehrspolizei. „Frau du Bois, wir bitten sie, uns zu begleiten. Es gab einen Unfall. Wir bringen sie in die Uni Klinik. Ihr Mann wurde schwer verletzt. Er liegt auf der Intensivstation.“ Der Boden unter ihren Füssen schien sich zu drehen, wie die Plattform eines Karussells. Stephanie begann am ganzen Leib zu zittern, als sie die Nachricht hörte. Sie strauchelte. Hilflos suchte sie Halt. Gerade noch rechtzeitig griffen die beiden Beamten ihr unter die Arme. Sie wäre sonst mit Sicherheit zu Boden gefallen. Hastig, fast schon mechanisch zog sie ihren Mantel vom Kleiderhaken, warf ihn sich über und stürmte aus dem Haus. Während die Tränen in ihre Augen schossen. Ihre Gedanken, jagten, wie wilde Hunde balgend, durch ihr Hirn. Sie überschlugen sich im Zeitraffertempo. Tausend Szenarien stürzten wie tosende Unwetter auf sie ein.
Der Chefarzt der Intensivstation empfing sie mit professionellem Bedauern im Gesicht. Stephanie ahnte Schreckliches. Sie hoffte verzweifelt auf einen Irrtum. „Frau du Bois, es tut mir leid, wir konnten nichts mehr für ihren Mann tun.“, sagte der Arzt, während er ihre eiskalte Hand zur Begrüßung zu fest drückte.
Die Tage und Wochen danach erlebte Stephanie wie in Trance. Die Trauerfeier organisierte ihre Mutter. Die Geschäfte übernahm der Vater, bis ein Prokurist eingesetzt war. Selbst ihr Bruder kümmerte sich um sie. Wenn auch nicht uneigennützig. „Alles vorbei, alles sinnlos, alles aus.“. Das waren die einzigen Gedanken die Stephanie beschäftigten. „Zu spät, für später.“. Ohne Bedeutung waren ihre Wünsche und Träume für die
Zukunft geworden. Ausradiert, in einem Augenblick der die Unendlichkeit in sich barg. Die Trauer um Bob hielt sie gefangen. Ebenso die Aussichtslosigkeit und die Leere in ihrem Leben. Vielleicht wäre in diesem Augenblick ein Baby ihr einziger Trost gewesen. Doch auch dafür war es nun zu spät.
Das Flugticket in ihrer Hand war die letzte Bindung zur Vergangenheit. Sobald sie das Ende der Gangway erreichte, würde auch die letzte Brücke zu ihrem alten Leben abgebrochen sein. Ein one way Ticket nach Amerika. Sanft drückte sie der Schub beim Start der Maschine in ihren Sitz. Sie atmete tief ein, schloss ihre Augen und flog einer unbekannten Zukunft entgegen. Bereit den Neuanfang zu wagen. In Jackson Hole hatte Stephanie endlich wieder zu sich gefunden.
Eine kleine Stadt am Rande des Grand Teton Nationalparkes. Die Einwohner leben von den vielen Touristen, die in ihrem Urlaub das Gefühl des Marlboro Mannes, aus der Zigarettenwerbung, spüren wollen. In Jackson Hole atmet man tatsächlich noch den „wilden Westen“. Selten finden sich Orte wo Vergangenheit und Gegenwart so harmonisch ineinander übergehen. Westernromantik pur. Eine Kleinstadt voller Entertainment für den durchreisenden Besucher. Tagesgeschäft für die Einheimischen.
Bereits früh am Morgen reiten unrasierte Cowboys auf dem Rücken ihrer Pferde die Hauptstrasse entlang. Selbst der Sheriff fährt nicht mit dem Auto. Betritt man den Drug Store, glaubt man sich auf einer Zeitreise zu befinden. Im Saloon knarren die hölzernen Schwingtüren und man ist fest davon überzeugt, John Wayne käme in der nächsten Minute herein. Im alten Barber - Shop steht der gefüllte Wasserkrug aus Emaille jederzeit bereit, um nach erfolgter Rasur die Schaumreste aus den geröteten Männergesichtern zu spülen. Die alte Mrs. Miller trägt die Post aus und hat für jeden ein freundliches Wort. Eine idyllische kleine Stadt, wo Jeder Jeden kennt. Gepflegte Vorgärten rahmen die alten Holzhäuser ein. Abends sitzt man auf der Veranda im Schaukelstuhl, und betrachtet den klaren Sternenhimmel. Das Rad der Zeit scheint hier still zu stehen. Am Horizont zeichnen sich die Rocky Mountains schemenhaft ab.
Stephanies kleines Appartement liegt etwas Abseits von der Hauptstrasse. Einfach ausgestattet, nur mit dem Nötigsten. Direkt unter ihrem Wohnbereich ist ein kleiner Laden. Geschmackvoll, jedoch sparsam, hat sie ihn eingerichtet. Hier bietet sie ihre Aquarelle und Ölbilder zum Verkauf an. Seit sie in Jackson Hole lebt, hat sie ihre Leidenschaft zur Malerei neu entdeckt. Oft ist sie Tage lang in der Umgebung unterwegs, auf der Suche nach geeigneten Motiven. Sie vergisst beim malen Zeit und Raum. Manchmal verliert sie sich regelrecht in ihren Bildern. Die Ruhe und Schönheit der rauen Wildnis halten sie in atemloser Gefangenschaft. Faszinierende Landschaftsbilder entstehen bei diesen Ausflügen. So voller Kraft und Ausdruck, voller Lebendigkeit und Farben. Jedoch kann der Betrachter auch eine Spur von Sehnsucht und Rastlosigkeit darin gespiegelt sehen.
Freunde hatten ihr bereits vor Jahren geraten, die Bilder zum Verkauf anzubieten. Zunächst fiel es ihr schwer sich von ihnen zu trennen. Doch im Lauf der Zeit hatte Stephanie gelernt, einmal mehr Abschied von ihren Werken zu nehmen. Allerdings sah sie ihren Kunden bei jedem Verkauf direkt in die Augen. Und nur dann, wenn sie darin diesen Funken an Begeisterung entdecken konnte, den sie selbst tief in sich verspürte, nur dann überließ sie ihre Bilder guten Gewissens dem Käufer. Sie ist inzwischen eine gefragte Künstlerin geworden, ein Geheimtipp für Kenner der Kunstszene. Galerien in Salt Lake City und Helena haben bereits einige ihrer Bilder angekauft.
Erst kurz vor Weihnachten bekam sie einen Anruf von Harrison Ford. Er lebt auf seiner Ranch ganz in der Nähe von Jackson Hole und interessiert sich ebenfalls für zwei ihrer Aquarelle.
Stephanie schmunzelt bei dem Gedanken an das Telefonat. Sie war vollkommen unvorbereitet und sehr erschrocken, als Harrison sich meldete. Wenn er auch nur geahnt hätte, wie sehr sie für ihn und seine Filme schon als Teenager geschwärmt hatte. Sie konnte die vielen Stunden kaum zählen, die sie allein seinetwegen im Kino verbrachte. Ja, sie war damals mit Sicherheit sogar ein wenig verliebt in Han Solo und Indiana Jones. Zum Glück würde er dies nie erfahren. Es wäre ihr heute ziemlich peinlich. Aber sie bekam immer noch eine Gänsehaut wenn sie sich zurückerinnerte.
Das schrillen des Telefons riss Stephanie aus ihren Gedanken. Wer wollte ausgerechnet heute am frühen Silvesterabend etwas von ihr? War nicht ganz Jackson Hole schon auf der großen Party? Die Vorbereitungen dafür hatten bereits im September begonnen.
„Du Bois“, meldete sich Stephanie etwas mürrisch. Am anderen Ende der Leitung blieb es einen Moment lang still. Schon wollte sie den Telefonhörer auf legen, da hörte sie ein ebenso besorgtes wie knappes „Doc Baker am Apparat“. In diesem Moment atmete Stephanie tief durch. Mit allem hatte sie gerechnet, einem Anruf aus Deutschland von ihren Eltern oder ihrem Bruder. Einem Rückruf der Galeristin aus Salt Lake City, die ihr letzte Vorschläge für die Vernissage im Januar unterbreiten würde. Nun konnte sie ihre Unruhe kaum unterdrücken. „Hallo Doc, was gibt es noch
so dringendes im alten Jahr?“. Sie bemühte sich, ihre Fassung zu bewahren. Doch es gelang ihr nur sehr unzureichend.
Wie sehr hatte sie nach dem letzten Besuch in seiner Sprechstunde gehofft, er möge ihr das Untersuchungsergebnis erst im neuen Jahr mitteilen. Sie hatte Angst. Angst seit dem Augenblick, als sie unter der Dusche stand und diese Schwellung ertasten konnte. Links, direkt unter der Achsel. Zunächst konnte und wollte sie nicht wahr haben, was sie da erfühlte. Ja, sie hatte viel gelesen über Früherkennung und moderne Behandlung von Brustkrebs. Sie wusste, dass die Chancen bei rechtzeitiger Entdeckung recht hoch waren, den Krebs zu bekämpfen. Sie hatte ihn schon einmal erfolgreich besiegt. Doch nun, als sie Doc Bakers Stimme hörte, waren alle ihre Gedanken überdeckt von dieser schrecklichen, erneut aufkeimenden Angst.
Doktor Baker bat Stephanie noch heute zu ihm in die Praxis zu kommen. „Es ist wirklich sehr dringend“, sagte er. „O.k.“, antwortete sie. Was hätte sie auch sagen sollen? Was hätte sie fragen können? In diesem Moment war nichts mehr so, wie es gerade eben noch schien. Mit diesem Anruf hatte sich ihr Leben erneut verändert. Sie fühlte es und gleichzeitig fühlte sie nichts als eine große Leere. Sie dachte nichts und ahnte doch alles. Losgelöst von allem was sie umgab starrte sie wie gebannt auf das Bild von Bob, vor ihr auf der alten Kommode. Doch sie sah absolut nichts. Während der Doktor den Hörer längst aufgelegt hatte, stand Stephanie wie erstarrt mitten im Zimmer. Gelähmt vor Angst. Sie bemerkte nicht einmal die heißen Tränen, die ihr über die Wangen liefen.
Als sich ihre Erstarrung löste ging sie in Richtung der Kommode. Sie nahm das Bild von Bob in beide Hände, zupfte mit zitternden Händen den Trauerflor gerade und versank in ihrer Vergangenheit. Alte Erinnerungen wurden hervor gespült. Sie sah den Park in dem sie Bob zum ersten Mal begegnete, hörte seine Stimme. Spürte den ersten zärtlichen Kuss. Gerade jetzt, in diesem Moment war er ihr so nahe, wie seit Jahren schon nicht mehr. Gemeinsam hatten sie damals ihre Krankheit besiegt. Sie war Bob dafür unendlich dankbar. Der Wind schlug den Fensterladen gegen die Hauswand. Dieses Geräusch ließ sie zurückkehren in das Hier und Jetzt. Seufzend nahm sie ihre dicke Jacke vom Garderobenhaken und zog die Tür kraftlos hinter sich zu, als sie ihr Appartement verließ.
Der Abend war von kristallklarer eisiger Kälte. Sie hoffte ihr alter Dodge würde sie nicht ausgerechnet jetzt im Stich lassen. Gleich im neuen Jahr wollte sie ihn in die Werkstatt bringen. Jack würde sicher versuchen ihr das alte Gefährt auszureden und sie dazu überreden, sich endlich ein neues Auto zu kaufen. Doch wozu? Der Wagen war ihr ans Herz gewachsen, so wie alles hier in Jackson Hole. Ihr ganzes neues Leben.
Der Frost knisterte in der Benzinleitung. Er benagte sie, wie ein alterschwacher Biber, den jungen Baum. Stephanie rieb sich die Kälte aus den Händen, hauchte ihnen Leben ein und versuchte minutenlang das Fahrzeug zu starten. Endlich, aufjaulend wie ein junger Wolf, sprang der Wagen an. Ächzte alterschwach, als ob man ihn aus seinem Dornröschenschlaf unsanft geweckt hätte. Erleichtert atmete sie auf und fuhr los. Menschenleer war die Stadt um diese Zeit. Die Silvesterparty war bereits seit zwei Stunden in vollem Gang. Die Holzhäuser hatten dicke Pudelmützen aus Schnee auf ihren Dächern. Stephanie glaubte das Knarren der Balken deutlich hören zu können. Natürlich war das vollkommener Unsinn. Denn alles was zu hören war, war das Klappern im Getriebe des Dodge. Doc Baker wohnte einige Meilen vor der Stadt. Um diese Zeit, war es ein ziemlich beschwerlicher Weg zu ihm hinauf. Die Strasse war unbeleuchtet und vom Schnee fast vollkommen zugeweht.
Dafür hatte der alte Doktor die schönste Aussicht aus dem Fenster seiner Praxis. Direkt auf die Silhouette des Grand Teton konnte man blicken. Majestätisch erhob er sich unter dem klaren Himmel. Stephanie liebte das Bergmassiv. Während sie die Strasse entlang fuhr, erinnerte sie sich an die alte Zeitung aus dem Stadtarchiv in Jackson Hole. Darin hatte sie gelesen, dass französische Pioniere beim Anblick der Berge sofort an weibliche Brüste dachten. Da das Wort Brüste im französischen mit „teton“ übersetzt wird, bedurfte es nicht viel Phantasie um zu erahnen wie das Gebirge letztendlich zu seinem Namen kam. Eigentlich hätte sie von allein darauf kommen können, waren doch auch ihre eigenen Vorfahren Franzosen. „Grand Teton“, dachte Stephanie und Bitterkeit überrollte sie. Im Moment wäre ihr schon geholfen, wenn ihre Brüste gesund wären. Groß müssen sie deshalb nicht sein. Denn eigentlich war sie zufrieden mit dem, was die Natur ihr mitgegeben hatte. Sie zwang sich zur Ruhe und bemühte sich, die Gedanken an Chemotherapie, Bestrahlungen, ausgehende Haare und tagelange Übelkeit zu vertreiben.
Sie wusste was sie erwartete, doch würde sie den Kampf erneut gewinnen? All die Tortouren, alle Höhen und Tiefen. Wochen und Monate der Ungewissheit. Bob war nicht mehr an ihrer Seite. Er fehlte ihr auch ohne diese schreckliche Krankheit sehr. Wie sollte sie dies alles allein bewältigen? Als sie die Einfahrt zu Doc Bakers Haus entlang fuhr, glaubte sie Bob’s Gestalt zu sehen, der ihr aufmunternd zu lächelte. Hastig wischte sie sich über die Augen, strich sich eine Strähne ihres
dunkel braunen Haares aus dem Gesicht. Als sie in den Rückspiegel blickte, war nichts zu sehen. Kein Schatten, keine Gestalt und schon gar nicht Bob. Ihre Nerven schienen ihr einen Streich gespielt zu haben. Sie dachte nicht weiter darüber nach. Sie parkte den Dodge etwas abseits vorm Haus und stieg langsam aus. Auf der Treppe drehte sich Stephanie noch einmal um, blickte zum Himmel der von Sternen übersät war. „Wenn du dort oben tatsächlich über mich wachst, gib mir die Kraft, dies alles zu überstehen.“ murmelte sie leise vor sich hin, während sie den Schnee von ihren Stiefeln abschüttelte. Der alte Doc Baker öffnete die Tür noch bevor sie klopfen konnte. Herzlich bat er sie herein und nahm ihr die Jacke ab. Das Teewasser brodelte im Kessel, während er die klobigen Teepötte aus dem Schrank holte. Stephanie nahm erwartungsvoll im Praxiszimmer Platz. Als er sich ebenfalls, in seinem alten Ledersessel, ihr gegenüber zu recht gesetzt hatte, wurde die Ungewissheit für Stephanie unerträglich. Fest sah sie ihn an, nun auf das Schlimmste gefasst. Der Doktor blätterte in seinen bereitgelegten Unterlagen, rieb sich das unrasierte Kinn, schloss das Krankenblatt und legte es zurück in die Schublade des alten wurmstichigen Schreibtisches.
Vorsichtig hob er die Tasse aus welcher der Tee heiß herausdampfte, nahm einen bedächtigen Schluck, bevor er zu ihr aufsah. „Kindchen, ich hoffe ich habe dich nicht zu sehr erschreckt“, sagte er. „Oh doch, das hast du. Du glaubst gar nicht wie.“, dachte Stephanie voller Ungeduld. Sie versuchte ein unsicheres Lächeln und antwortete: „Doc, was ist los mit mir? Ist es das, was ich vermute?“. Stephanie hatte Mühe ihre Tränen zu unterdrücken. Am liebsten hätte sie ihm die Antwort auf ihre Ungewissheit aus dem Leib geschüttelt. Sie rang um Beherrschung. „Kindchen“, so sprach Doc. Baker weiter, „ich wollte dich nicht erschrecken“. Doch als die Laborberichte heute am frühen Morgen aus Helena kamen, hielt ich es für angebracht, dich nicht im Unklaren in das neue Jahr zu entlassen.“ Stephanies Hände krampften ineinander. „Herrgott noch mal, so rede doch endlich.“, hämmerte es in ihrem Schädel. Ob sich der Doktor im Klaren darüber war, wie es ihr im Moment ging? Sicherlich nicht, sonst hätte er sich mit seinen Worten nicht so viel Zeit gelassen. „Also, meine Liebe, die Testergebnisse sehen sehr gut aus. Die Schwellung unter der Achsel ist eine harmlose Entzündung. Womöglich hast du dich etwas zu sehr überanstrengt beim renovieren deines Appartements. Kein Grund zur Besorgnis.“
Stephanie konnte kaum fassen, was sie da gerade hörte. Eine Welle von Dankbarkeit durchströmte ihren Körper. Alle Anspannung viel von ihr ab. Am liebsten wäre sie dem alten Doc vor Freude um den Hals gefallen. Sie atmete erleichtert auf. „Danke, du da oben. Wer immer du sein magst. Wo immer du auch bist. Ich danke dir!“. Einem Stoßgebet gleich flogen diese Sätze durch ihren Kopf. Nein, eigentlich war sie kein religiöser Mensch. Sie hatte ihren Glauben viel zu oft auf harte Proben stellen müssen, nahe der Verzweiflung. Doch irgendetwas da draußen in der Unendlichkeit, irgendwer schien über sie zu wachen. Davon war sie nun fest überzeugt. Es war ihr im Moment egal ob es Bob war, man von einem Gott sprechen konnte, oder vom Geist der Silvesternacht. Sie wusste es selbst nicht genau, doch sie fühlte sich behütet und stark wie selten zu vor.
Als sie sich vom alten Baker verabschiedete, rückte das neue Jahr immer näher. Sie wünschte ihm alles Gute und drückte ihm fest die Hand. Es war bereits nach 23:00Uhr und ihr alter Dodge hustete die Strasse entlang. Bevor sie die Stadtgrenze erreichte blickte sie nach links in die Nacht, in die Richtung der Ranch von Harrison. Auch ihm wünschte sie still ein erfolgreiches neues Jahr. Kurz vor Mitternacht erreichte sie ihr Appartement. Das Feuer im Kamin knisterte leise, ihr Tannenbaum strahlte im Licht der Kerzen. Sie ging in ihre Küche um eine Flasche Wein zu öffnen. Während sie den schweren Rotwein in einen alten Kelch goss ging sie an ihren Schreibtisch. Stephanie öffnete die Schublade und zog ihr Tagebuch heraus. Lange hatte sie ihm nichts mehr anvertraut. Wenn sie es recht überlegte, endeten ihre Aufzeichnungen mit dem Ausbruch ihrer Erkrankung vor mehr als 13 Jahren. Doch heute musste sie ihm noch einige letzte Worte hinzufügen, bevor das alte Jahr zu Ende geht. Sinnlos
Haare fallen,
doch nicht von der Schere Schnitt.
Haut verbrennt,
doch nicht von der Sonne Glut.
Allmorgendliche Übelkeit,
doch nicht von der Frucht des Leibes.
Medikamente verzehrend,
doch nicht um zu Gesunden.
Trotz allem – Sterben.
(Sommer 1991) Sie strich den letzten Satz aus und schrieb darunter: „Trotz allem – Leben.“
(Silvester 2004)
Während es von der Kirchturmuhr Mitternacht schlug, und Stephanie ihr Tagebuch schloss, blickte sie hinaus aus dem Fenster, in die Neujahrsnacht. Sie erhob ihr Weinglas und prostete stumm ihrem Spiegelbild zu. Als sie sich vom Fenster abwandte fiel ihr Blick auf die alte Kommode. Genau dort hin wo Bob’s Bild stand. Es war, als lächelte er ihr ebenfalls zu, um ihr ein wunderschönes und vor allem gesundes neues Jahr zu wünschen.
|
|
|
Last update: 18.09.13, 12:00
status
du bist nicht eingeloggt » login
menü
suchen
| November 2025 |
|---|
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | | | September | | |
neue Beiträge
» ...
Geschirrspülgedanken (Sie wissen, was ich meine)
... also manchmal ja, manchmal bin ich so richtig, richtig, richtig froh, dass mich hier niemand wirklich beobachten kann ...
Nun sitze ich hier, schüttle den Kopf über mich selbst und staune tatsächlich über meine eigene, dann doch wohl, kindliche Naivität.
Warum? Ich werde es Euch verraten, ...
sorceress2001 @ 18.09.13, 12:00 » ...
Geschirrspülgedanken (Sie wissen, was ich meine)
Zwei Fotos + jahrzehntealte Erinnerungen + Assoziationen = Synapsenfasching zur Geisterstunde.
oder
Wie man zur Geisterstunde seinen ganz privaten Horrorfilm sieht.
Der Mensch träumt und das ist normal. Manche erleben in ihren Träumen intensive Gefühle, sehen fabelhafte Bilder, können unglaubliche Dinge tun. Andere träumen und können sich daran ...
sorceress2001 @ 18.09.13, 11:58 » ...
Geschirrspülgedanken (Sie wissen, was ich meine)
Es ist Sonntag und zwar der letzte Sonntag vor der Bundestagswahl 2013. Im Grunde ein Sonntag, wie es viele davor gab und wie es viele danach noch geben wird. Seit geraumer Zeit quälen mich - Glaubensfragen - und dies nicht nur an Sonntagen sondern nahezu ...
sorceress2001 @ 18.09.13, 11:54 » ...
Geschirrspülgedanken (Sie wissen was ich meine)
gentlewoman's agreement - ... stille Übereinkunft ...
Immer wenn ich in diesem großen Haus aus dem Fahrstuhl steige, beginnt mein Herz lautstark zu klopfen, mein Puls erhöht sich und manchmal denke ich, man sieht es mir an. Aber das ist Quatsch, die Menschen welche mir hier ...
sorceress2001 @ 18.09.13, 11:53 » ...
Geschirrspülgedanken (Sie wissen, was ich meine)
... also manchmal ja, manchmal bin ich so richtig, richtig, richtig froh, dass mich hier niemand wirklich beobachten kann ...
Nun sitze ich hier, schüttle den Kopf über mich selbst und staune tatsächlich über meine eigene, dann doch wohl, kindliche Naivität.
Warum? Ich werde es Euch verraten, ...
sorceress2001 @ 18.09.13, 11:51
|
|